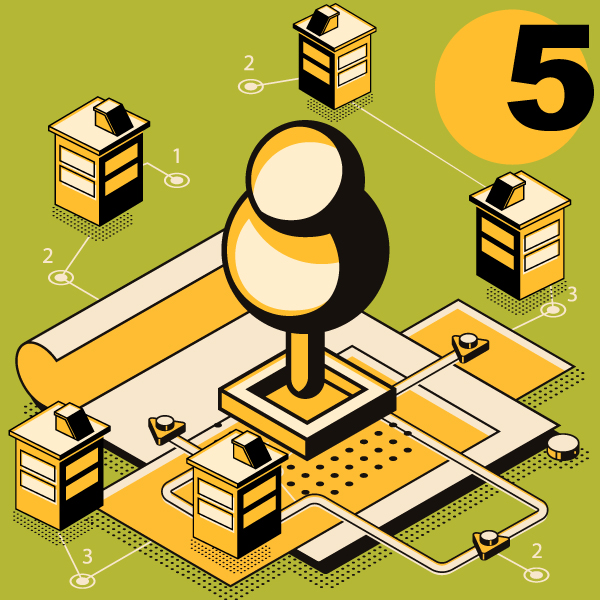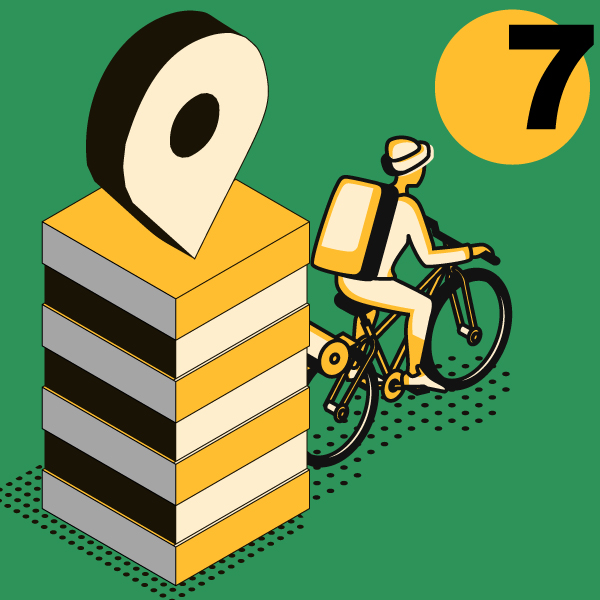Partizipative Umsetzung/Methoden
1. Definition und Ziele
Die Bürgerbeteiligung oder Partizipation spielt in deutschen Kommunen bereits seit geraumer Zeit eine Rolle und ihre Bedeutung nimmt stetig zu. Dies betrifft auch die Planung von Verkehrsprojekten. Oft stellt sich die Frage, wie die Beteiligung erfolgreich durchgeführt werden kann, so dass alle Nutzer- und Bevölkerungsgruppen in die Planung einbezogen und deren Belange und Perspektiven eingebracht werden und am Ende ein Ergebnis steht, dass von vielen getragen wird.
-
- Formen der Beteiligung
Bei der Beteiligung insbesondere in Planungsprozessen wird zwischen formeller Beteiligung und informeller Beteiligung unterschieden. Die formelle Beteiligung ist gesetzlich festgelegt und umfasst zum Beispiel die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Träger öffentlicher Belange im Planfeststellungsverfahren oder auch Wahlen und Bürger- bzw. Volksentscheide. Bei Verkehrsprojekten im Rahmen von Planfeststellungsverfahren müssen die formellen Vorgaben zur Beteiligung der Öffentlichkeit beachtet werden. Häufig werden jedoch, und in den letzten Jahren in zunehmenden Maße, über die formelle Beteiligung hinaus weitere informelle Verfahren der Beteiligung durchgeführt, um möglichst viele Zielgruppen auf unterschiedliche Weise schon zu einem frühen Zeitpunkt in die Planung einzubeziehen und gegebenenfalls auch mit den potentiellen Nutzergruppen gemeinsam Konzepte oder Planungen zu entwickeln. Da die informelle Beteiligung nicht gesetzlich geregelt ist, kommen hier sehr viele unterschiedliche Formate und Prozesse zur Anwendung (s.u.).
- Formen der Beteiligung
-
- Formate der Beteiligung
Bei der Durchführung von Bürgerbeteiligung können eine Vielzahl unterschiedlicher Formate und Methoden zur Anwendung kommen. Die Auswahl der Methoden richtet sich nach den Zielen der Beteiligung, den einzubindenden Bevölkerungsgruppen und der Stufe der Beteiligung (Fokus auf Information, Dialog oder Mitwirkung). Für ein geplantes Projekt sollten idealerweise mehrere aufeinander abgestimmte und sich ergänzende Formate in einem Beteiligungsprozess zusammengeführt werden, um unterschiedliche Zielgruppen (organisierte Akteure, Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Bürger*innen, Anwohner*innen, schwer erreichbare Gruppen) mit unterschiedlichen Rollen in unterschiedlicher Intensität einzubinden und die Ergebnisse in den Politikprozess einfließen zu lassen. Zu den verwendeten Formaten gehören z.B. Bürgerdialoge oder Bürgerversammlungen, Bürgerwerkstätten, Bürgerräte, Befragungen, Online-Dialoge, Planspiele, Planungszellen, Zukunftswerkstädte oder Open Space-Konferenzen. Die Bürgerbeteiligung sollte möglichst von einem neutralen Prozessdurchführer moderiert werden, der dafür sorgt, dass die Kriterien guter Beteiligung eingehalten werden.
- Formate der Beteiligung
2. Probleme und Herausforderungen
Die größte Herausforderung bei der Beteiligung ist es, einen guten Beteiligungsprozess aufzusetzen, der wahre Beteiligung ermöglicht und nicht nur zum Schein beteiligt. Um einen guten Beteiligungsprozess mit ernstgemeinten Handlungsspielräumen zu gewährleisten, muss bei der Durchführung von Beteiligungsprozessen auf einige Qualitätskriterien geachtet werden, zu denen in den letzten Jahren im Diskussionsprozess der Beteiligungsforschung und -anwendung Konsens hergestellt wurde. Hierzu gehören:
-
- Frühzeitige Information und Beteiligung
- Transparente Information: Veröffentlichung aller für den Prozess relevanten Informationen
- Ergebnisoffenheit sowie klare Kommunikation von Entscheidungsspielräumen und Einflussmöglichkeiten (sowie von Parametern, die nicht mehr zu ändern sind)
- Klare Kommunikation im Vorhinein, wie die Ergebnisse der Beteiligung verwendet werden und den weiteren politischen Prozess beeinflussen werden
- Klare Kommunikation im Nachhinein, wie sich Entscheidungsträger mit den Ergebnissen auseinandergesetzt haben, welche Ergebnisse wie in den Entwicklungs- und Planungsprozess aufgenommen wurden bzw. aus welchen Gründen bestimmte Ergebnisse ggf. nicht weiterverfolgt werden konnten (Rückmeldung zu den Ergebnissen)
- Beteiligung vieler verschiedener Zielgruppen wie Bürger*innen, Gewerbetreibende, die direkt betroffenen Zielgruppen sowie die Kommunalpolitik, Verwaltungen und Ämter.[1]
In den letzten Jahren haben sich immer mehr Kommunen außerdem in einem partizipativen Prozess ihre eigenen Leitlinien der Beteiligung entwickelt, in denen die Qualitätskriterien sowie weitere Maßnahmen für eine gute Beteiligung festgehalten sind (z.B. Berlin (Leitlinien für Beteiligung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen), Freiburg im Breisgau, Stuttgart, Heidelberg, Graz und viele mehr).
Gerade bei der frühzeitigen Beteiligung gilt es, das sogenannte Beteiligungs-Paradox zu beachten. Dies besagt, dass je frühzeitiger beteiligt wird – und je mehr Handlungsspielräume noch bestehen -, desto weniger sind Bürger*innen und Betroffene (noch) an dem Thema interessiert, während das Interesse mit dem Fortschreiten des Prozesses - und immer weniger Handlungsspielräumen – größer wird. Bei der frühzeitigen Beteiligung müssen daher ein besonderes Augenmerk und Ressourcen auf die Aktivierung der Zielgruppen gelegt werden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, die Bürger*innen per Zufallsauswahl aus dem Melderegister zu ziehen und anzuschreiben und so für das Thema frühzeitig zu aktivieren. So wird auch die Herausforderung umgangen, nur diejenigen zu erreichen, die direkt betroffen sind oder ohnehin schon eine festgelegte Meinung zum Thema haben.
Durch die Corona-Pandemie werden ein steigendes Interesse und ein zunehmender Bedarf an Online-Beteiligungsformaten bzw. an der Umwandlung von Offline- in Online-Formate oder in hybride Veranstaltungsformate deutlich. Über Video-Konferenzen und Webinare per Online-Tools wie Zoom oder WebEx steht bereits eine wachsende Palette an Funktionen bereit. So kann bspw. auch die Arbeit in Kleingruppen durch sog. „Breakout-Rooms“ online ermöglicht werden. Um die klassische Video-Konferenz „aufzulockern“ eignen sich zusätzlich Umfrage-Tools wie z.B. Mentimeter, um die Interaktion zu befördern. Auch die Einbindung von Videos und gezielte Pausen tragen zur konstruktiven Arbeitsatmosphäre bei.
[1] s. auch: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (Hrsg,) (2019). Leitlinien für Beteiligung von Bürger*innen an der räumlichen Stadtentwicklung.
3. Mögliche Auswirkungen und möglicher Beitrag zu einer klimafreundlichen Mobilität
Mobilität ist eng an die individuelle Alltagsgestaltung der Bürger*innen geknüpft. Daher ergeben sich für den Mobilitätssektor durch Beteiligung große Potenziale, um das Verständnis für die Notwendigkeit einer Mobilitätswende und die Akzeptanz für Maßnahmen zur Förderung alternativer Mobilitätsformen zu erhöhen. Die Mobilitätswende kann nur Hand in Hand mit einem gesellschaftlichen Wandel / Umdenken umgesetzt werden, wenn die Bürger*innen sich für nachhaltige Mobilitätsoptionen entscheiden und diese auch nutzen.
Beteiligung kann bei guter Durchführung unter Beachtung der Qualitätskriterien zu breit akzeptierten Lösungen führen. Die Einbindung unterschiedlicher Perspektiven und Wissensformen, insb. lokalen Wissens, kann die politische Entscheidungsgrundlage erheblich bereichern. Eine repräsentative Zufallsauswahl von Bürger*innen kann – vor allem bei politisch brisanten Themen – zudem verhindern, dass sich nur die „üblichen Verdächtigen“ oder direkt Betroffene am Prozess beteiligen, sondern Personen unterschiedlichen Wissensstands und mit unterschiedlichen Meinungen zum Thema. Auf diese Weise werden durch den Bevölkerungsquerschnitt im Kleinen eine allgemeingesellschaftliche Perspektive - und nicht nur die individuelle Betroffenheit - eher befördert.
Fachinformationen und wissenschaftliche Studien
Allgemeine Informationen zu Beteiligung und Methoden/Formaten der Beteiligung
Partizipative Forschung mit Kindern und Jugendlichen (Bertelsmann Stiftung 2022)
Studien, Bücher, Fachartikel
In dieser Publikation geht es um die Bedeutung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, welche von Anfang in Partizipationsprozesssen an mitgedacht werden müssen.
Einblicke in die Beteiligungslandschaft Baden-Württembergs (Bertelsmann Stiftung 2021)
Studien, Bücher, Fachartikel
Im Zuge dieser Studie wurden Daten hinsichtlich der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern auf kommunaler Ebene in Baden-Württemberg erhoben. Baden-Württemberg fungiert im Beteiligungskontext als Vorbild.
Treiber und Hemmnisse in Reallaboren – Erkenntnisse zu nachhaltiger Mobilität, Innenstadtbelebung und Partizpation (Öko-Institut 2022)
Positions-/Diskussionspapier
In diesem Papier geht es um Reallabore und ihre Bedeutung hinsichtlich im Titel genannter Themenbereiche.
Gute Beteiligung stärkt die lokale Demokratie (Bertelsmann Stiftung 2019)
Positions-/Diskussionspapier
In diesem Papier von der Bertelsmann Stiftung geht es um eine Befragung von Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich Kommunalwahlen, die in 2019 stattgefunden haben. Es ging einerseits darum, Erkenntnisse über diese Wahlen zu bekommen sowie um die Erwartungen, welche an die Kommunalpolitik gestellt werden.
Methodenplattform Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Österreich
Webseite
Die Seite bietet Basiswissen zum Thema Beteiligung und stellt viele unterschiedliche Beteiligungsmethoden sowie Praxisbeispiele aus Österreich dar. Ebenso kann anhand bestimmter Kriterien nach Methoden gesucht werden.
Beteiligungskompass der Bertelsmann Stiftung und der Stiftung Mitarbeit
Die Plattform bietet praxisrelevante Informationen für eigene Vorhaben der Bürgerbeteiligung wie Basiswissen, Planungshilfen und Leitfäden, Praxisbeispiel und Informationen zu Methoden der Beteiligung.
Partizipation und nachhaltige Entwicklung in Europa
Die Seite bietet Praxiswissen, Methoden, Praxisbeispiele und weitere Links zu Beteiligung (vor allem in Österreich)
Methodenhandbuch Bürgerbeteiligung in der Praxis, Stiftung Mitarbeit (2018)
Leitfäden / Handbücher
Beschreibung von mehr als 30 Methoden und Formaten der Bürgerbeteiligung, jeweils mit Praxisbeispiel(en).
Qualitätskriterien und Leitlinien der Beteiligung
Übersicht partizipativer Methoden der nexus Akademie
Die nexus Akademie für Partizipative Methoden fördert Beteiligungskultur durch Beratung und Konzeption, Durchführung und Moderation, Begleitung und Evaluation sowie Schulung und Coaching.
Qualitätskriterien Bürgerbeteiligung im Netzwerk Bürgerbeteiligung (2013)
Leitfäden / Handbücher
Beschreibt die Qualitätskriterien für Bürgerbeteiligung des Netzwerks Bürgerbeteiligung.
Leitlinien für die Beteiligung von Bürger*innen an Projekten und Prozessen der räumlichen Stadtentwicklung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin (2019)
Leitfäden / Handbücher
Diese Leitlinien wurden erarbeitet, um den Dialog mit der Stadtgesellschaft Berlins zu stärken. Leitlinien für Beteiligung dienen dazu, Mitgestaltungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger zu strukturieren.
Sammlung kommunaler Leitlinien und Handlungsempfehlungen für die Bürgerbeteiligung
Leitfäden / Handbücher
Die Seite bietet eine Sammlung der meisten Leitlinien für Bürgerbeteiligung im deutschsprachigen Raum.
Praxisbeispiele aus verschiedenen Anwendungsfeldern und Kontexten
Hörspaziergang (Be-Move, Essen)
In der MobilitätsWerkStadt 2025 (MWS 2025) Be-Move werden Hörspaziergänge durchgeführt, bei denen anhand eines Fragebogens die subjektiven Wahrnehmungen der Teilnehmenden erfasst werden.
Das ZESmobil (NUDAFA)
Die MobilitätstWerkStadt 2025 (MWS 2025) NUDAFA erarbeitet mithilfe von datengestützten Planungsmethoden ein interkommunales Radverkehrskonzept.
Minecraft-Workshop für Kinder und Jugendliche (pimoo, Oberursel)
Im Zuge der Mobilitätswerkstadt 2025 (MWS 2025) pimoo wird mit diesem Workshop Kindern und Jugendlichen spielerisch ermöglicht, sich an der Gestaltung und Planung der zukunftigten Mobilität zu beteiligen.
Verkehrliches Leitbild (pimoo, Oberursel)
Leitfäden / Handbücher
Die MobilitätstWerkStadt 2025 (MWS 2025) pimoo hat partizpativ ein verkehrliches Leitbild mit sieben Leitzielen hinsichtlich der zukunüftigen Mobilität in der Stadt Oberursel im Taunus erarbeitet.
Bürgerveranstaltung Mobilitätskonzept Lincoln-Siedlung (NaMoLi 2, Darmstadt)
(Schluss-)Berichte
Dieser Bericht dokumentiert die Bürgerveranstaltung zur Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes für das neue Quartier Lincoln-Siedlung im Zuge der Mobilitätswerkstadt 2025 (MWS 2025) NaMoLi 2.
Verkehrliches Leitbild (pimoo, Oberursel)
Leitfäden / Handbücher
Die MobilitätstWerkStadt 2025 (MWS 2025) pimoo hat partizpativ ein verkehrliches Leitbild mit sieben Leitzielen hinsichtlich der zukunüftigen Mobilität in der Stadt Oberursel im Taunus erarbeitet.
StUB Stadt-Umland-Bahn, Nachhaltig mobil zwischen Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach (laufend)
Die Stadt-Umland-Bahn (StUB) soll künftig als Straßenbahn die Städte Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach als nachhaltige Alternative zum Pkw-Verkehr verbinden. Um die bestmöglichste Planung der Stadt-Umland-Bahn zu erzielen, setzt der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn auf eine aktive Beteiligung und transparente Information. Gemeinsam mit der Öffentlichkeit sollen optimierte Planunterlagen für das Raumordnungsverfahren und das Planfeststellungsverfahren erarbeitet werden.
Partizipationsverfahren zur Umgestaltung des Bushaltestellenumfeldes Farmsen
Beteiligung zur Optimierung des Busverkehrs – als Teil des Busbeschleunigungsprogramms – am Knotenpunkt U-Bahnhof Farmsen in Hamburg
Internationaler Dialog für Bürgerinnen und Bürger zum autonomen Fahren (The Mobility Debate 2019)
Zwischen April und Oktober 2019 diskutierten 850 Bürger*innen in 15 Städten in Europa, Nordamerika und Asien über die Zukunft mit autonomen Fahrzeugen. In jeder dieser Städte tauschten sich bis zu 100 Bürger*innen einen Tag lang über die wichtigsten Herausforderungen, Potentiale und Entwicklungen rund um das Thema autonomes Fahren aus. Das nexus Institut hat als nationaler Partner in Deutschland zwei Dialoge in Aachen und Paderborn durchgeführt
Planungszelle zum Bau einer Seilbahn in Wuppertal (2016)
Die Wuppertaler Schwebebahn ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Darüber hinaus ist eine Kabinenseilbahn geplant, die den Hauptbahnhof mit dem Schulzentrum Wuppertal-Cronenberg/Küllenhahn verbindet, die anspruchsvolle Topografie Wuppertals vergleichsweise einfach überwinden kann. Zur Diskussion des geplanten Projektes wurde eine Planungszelle durchgeführt.
Future City Lab – Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur
Reallabor in Stuttgart mit verschiedenen Realexperimenten zur Beteiligung der Bürger*innen
Pop-Up-Innenstadt Ludwigsburg (laufend)
Von 2021 bis 2023 wird sich durch das Projekt „Pop-Up-Innenstadt“ das Ludwigsburger Zentrum an vielen Stellen für eine kurze Zeit verwandeln. Durch „Pop-Up-Maßnahmen“ werden dabei Ideen zur Verbesserung von Mobilität und Klimaanpassung sowie zum Aufwerten und Beleben des öffentlichen Raums getestet.
Beweg Dein Quartier!
Das Projekt Beweg Dein Quartier will Mobilität zunächst in zwei Testquartieren neu denken (Essen und Offenbach am Main), Möglichkeitsräume eröffnen, neue Gewohnheiten etablieren und gemeinsam mit den Menschen vor Ort Projekte für eine bessere Mobilität der Zukunft und mehr Lebensqualität im Quartier entwickeln – und so zur Reduzierung der CO2-Emmissionen beitragen.
Beteiligung zur Luftreinhalteplanung in Reutlingen
Projektbegleitende Beteiligung zur Einbindung der Öffentlichkeit in die Erarbeitung der Luftreinhalteplanung. Neben der Einrichtung einer „Spurgruppe“ mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wurde auch eine Online-Kommentierung des Fachgutachtens durchgeführt.
Online-Beteiligung zum Mobilitätskonzept 2030 der Stadt Ahlen
Einrichtung einer interaktiven Karte zum Einholen von Anregungen und Ideen aber auch für Kritik der Bürgerinnen und Bürger an den Mobilitätsangeboten. Darüber hinaus konnten die Bürger*innen maßgebliche Handlungsansätze und konkrete Vorschläge bewerten und priorisieren.
https://www.ahlen.de/start/themen/bauen-planen/mobilitaet/mobilitaetskonzept/
Ergebnisse der Ideensammlung:
https://www.ahlen.de/fileadmin/pdf/Bauen_Umwelt/Verkehr/B%C3%BCrger_zu_Verkehrsthemen/200228_Dokumentation_Ideenkarte.pdf
 Einfache Sprache
Einfache Sprache