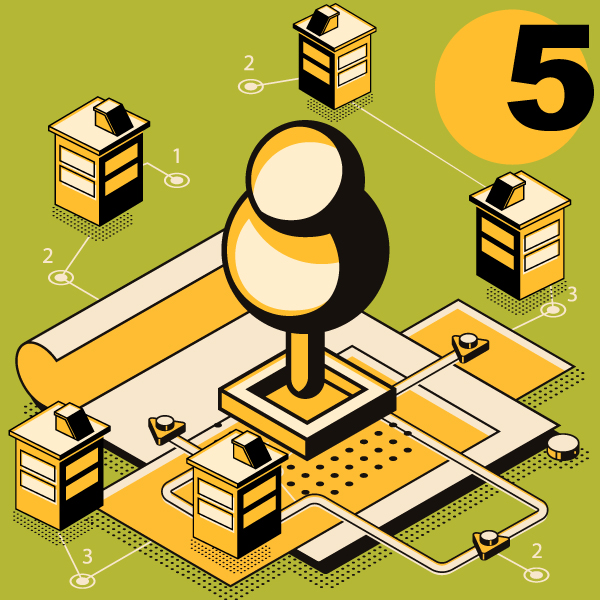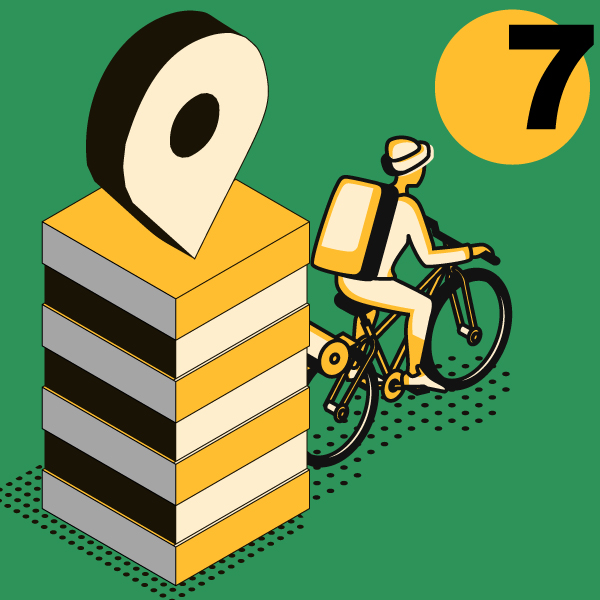Experimentierräume & Experimentierklauseln
Rechtliche Spielräume für die lokale Verkehrswende und die Nutzung von Experimentierklauseln
1. Definition und Ziele
Innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens ist mehr möglich als oft gedacht. Die Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) und des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) sowie das im Sommer 2021 in Kraft getretene neue Gesetz zum autonomen Fahren haben die Spielräume für die kommunale Verkehrspolitik erweitert.
Exemplarisch bedeutet das: Mithilfe von temporären Anordnungen lassen sich kurzfristig Maßnahmen umsetzen wie auch z. B. die Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen oder die Einrichtung von Pop-up Radwegen.
Beim Thema Parkraumbewirtschaftung haben die Stadtstaaten (Hamburg, Berlin, Bremen) die Möglichkeit, die Gebühren für die Bewohnerausweise selbst festzulegen. Die Kommunen in den Flächenländern müssen sich an die Richtlinien der jeweiligen Länder halten.
Nach dem neuen PBefG kann die Genehmigungsbehörde bzw. der Aufgabenträger die Rückkehrpflicht von Mietwagen nun selbst ausgestalten.
Mit dem Gesetz zum autonomen Fahren hat die Bundesregierung einen Regelungsrahmen geschaffen, der es erlaubt, dass zukünftig autonome Fahrzeuge ohne einen physisch anwesenden Fahrer in festgelegten Betriebsbereichen des öffentlichen Straßenverkehrs unter Bedingungen einer effektiven Fernüberwachung im Regelbetrieb fahren können.
Grundsätzlich haben Kommunen im Hinblick auf kommunale Straßen weitere Gestaltungsspielräume. Diese ergeben sich nicht zuletzt durch das 2018 erlassene Carsharing-Gesetz (CsgG) sowie das Elektromobilitätsgesetz (EmoG). Beide Rechtsgrundlagen erlauben Kommunen die Ausweisung von öffentlichen Ladestationen und Carsharing-Stellplätzen auf öffentlichen Flächen.
Diese rechtlichen Spielräume ändern aber nichts daran, dass der aktuelle Rechtsrahmen auf die bestmögliche und rechtssichere Regulierung des bestehenden Verkehrssystems ausgelegt ist. Das bestehende System wiederum ist durch die Dominanz des privaten Autos geprägt und das schlägt sich auch in der aktuellen Gesetzeslage nieder. Alternativen zulasten des Autoverkehrs zu stärken, erfordert von den Verkehrsverwaltungen Mut und eine Rückendeckung durch die politische Spitze. Dann erweist sich der rechtliche Rahmen als auslegefähig. Zudem bestehen mit den Experimentierklauseln Möglichkeitsräume für zulässige Abweichungen vom bestehenden rechtlichen Rahmen. In den meisten Fällen handelt es sich bei Experimentierklauseln um Ausnahmetatbestände, die eine Nichtanwendung oder Abweichung von einer bestehenden Rechtsnorm zulassen und so öffentlichen oder privaten Akteuren eine Erprobung von innovativen Mobilitätslösungen ermöglichen (sollen).
Im Bereich des Verkehrsrechts sind aktuell vor allem folgende Experimentierklauseln zentral:
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) § 2 Abs. 7:
„Zur praktischen Erprobung neuer Verkehrsarten oder Verkehrsmittel kann die Genehmigungsbehörde auf Antrag im Einzelfall Abweichungen von Vorschriften dieses Gesetzes oder von auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Dauer von höchstens fünf Jahren genehmigen, soweit öffentliche Verkehrsinteressen nicht entgegenstehen.“
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO): § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6:
„(1) Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben sie […] zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe sowie zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen.“
Grundsätzlich bestehen durchaus kommunale Handlungsmöglichkeiten und Innovationen im Verkehr sind auch möglich, ohne dass die Option der Experimentierklausel gezogen werden muss. Dennoch kann es sinnvoll und notwendig sein, die Möglichkeit einer Experimentierklausel zu nutzen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Projekte vorsehen, neu entwickelte Mobilitätskonzepte in den Kommunen in einem experimentellen Setting zu erproben. Bisher gibt es nur wenige gut dokumentierte Praxisbeispiele aus dem Mobilitätsbereich, die detaillierte Einblicke in die Anwendung von Experimentierklauseln erlauben.
2. Probleme und Herausforderungen
Die Anwendung von Experimentierklauseln für eine nachhaltige Mobilität gestaltet sich in der Praxis jedoch schwierig, wie sich mit Verweis auf das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und die Straßenverkehrsordnung (StVO) zeigen lässt. Alle Formen der gewerblichen Personenbeförderung im öffentlichen Nahverkehr werden derzeit – neben der StVO – insbesondere vom PBefG geregelt. Experimentierklauseln sind sowohl im PBefG als auch in der StVO vorgesehen. Die bisherigen rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der PBefG lassen es aber nicht zu, dass neue Angebotsformen in einem relevanten Umfang entwickelt und erprobt werden können. Das PBefG ist im Wesentlichen darauf ausgerichtet, den Markt der kommerziellen Personenbeförderung so zu begrenzen, dass der öffentliche Personennahverkehr und das Taxi vor Konkurrenz geschützt werden. Ein Aufgabenträger darf eine Ausnahme laut Gesetz nur dann genehmigen, wenn "öffentliche Verkehrsinteressen" dem nicht entgegenstehen. Mit Bezug auf die Experimentierklausel schreibt das Gesetz aber nicht streng vor, welche "öffentlichen Verkehrsinteressen" berücksichtigt werden müssen, sondern überlässt das weitgehend dem Ermessen der Genehmigungsbehörde und der Abwägung der örtlichen Interessen. Damit besteht immer eine beträchtliche Unsicherheit.
Im Rahmen der StVO, dem „Grundgesetz für die Regelung des Verkehrs auf Straßen“, bietet sich durch die Experimentierklausel zwar ebenfalls ein Rahmen für die Erprobung. Das Ziel der Erprobungen neuer Maßnahmen muss aktuell jedoch darin bestehen, die „Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs“ zu verbessern. Aktuelle Versuche müssen damit stets auf eine Gefahrenabwehr ausgerichtet sein, welche es auch nachzuweisen gilt. Zudem muss auch die Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Maßnahme zum prognostizierten Beitrag zur Verbesserung passen, um rechts- und klagesicher eine Experimentierklausel ziehen zu können.
Gerade die (berechtigte) Sorge vor Klagen, die Verkehrsversuche unterbinden wollen, schafft in den Kommunen hier viele Unsicherheiten und bindet auf Grund der notwendigen Vorbereitungen der Maßnahmen viele Ressourcen. Maßnahmen, die auf eine Neuaufteilung von Verkehrsflächen abzielen, um nachhaltige Mobilitätsformen (wie Rad- und Fußverkehr) zu stärken oder kommunalen Klimaschutz- und -resilienz in (bspw. durch Begrünungs- und Entsiegelungsmaßnahmen) zu fördern, können die aktuelle StVO-Experimentierklausel hierfür kaum nutzen.
Die Bezugnahme auf Experimentierklauseln, die als rechtliche Möglichkeitsspielräume vorgesehen sind, reicht im Regelfall nicht aus, um konkrete Projekte durchzuführen. Für die praktische Umsetzung von innovativen Mobilitätsprojekten und Verkehrsversuchen müssen meistens noch weitere Ausnahmeregelungen beantragt werden. Die Experimentierklausel des bestehenden Gesetzes stellt nur eine grundlegende Hilfskonstruktion dar, um beispielsweise Ridepooling auszuprobieren. Die zeigt sich beispielsweise in Pilotbereichen, in denen teilautonome Shuttle Busse getestet werden, die dem Prinzip des „Hub and Spoke“ folgen, d.h. Busse fahren auf Wunsch direkt vor die Haustüre und bringen die Passagiere an einen Hub, also einen Verkehrsknotenpunkt. Aber auch für diese Verkehre gelten hohe rechtliche Hürden. Da es noch keine Typengenehmigung für diese teilautomatischen Busse gibt, muss für jedes Fahrzeug einzeln eine Ausnahmegenehmigung nach § 21 und § 70 der Straßenverkehrs-Zulassungsverordnung (StVZO) beantragt werden. Die Strecke selbst wird ebenfalls begutachtet und eigens zugelassen. Der Shuttle braucht dann noch eine ausreichende Beschilderung entsprechend den Regelungen des § 29 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Um als Teil des öffentlichen Verkehrs unterwegs zu sein, benötigt der Betrieb dann noch eine Genehmigung als eigenwirtschaftlicher Linienverkehr nach § 42 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG). Die Erlaubnis eines solchen Betriebs wird in aller Regel mit einer Reihe von Auflagen versehen wie beispielsweise, die Festsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf maximal 15 km/h sowie strenge Anforderungen an das technische Begleitpersonal. Bislang werden diese Piloten zudem nur genehmigt, wenn eine Person – ein sogenannter Operator – an Bord ist.
Wie die kurze Darstellung der vielfältigen rechtlichen Anforderungen für den Betrieb autonomer Shuttles zeigt, ist ein sehr hohes Maß rechtlicher Expertise erforderlich, um innovative Mobilitätslösungen zu erproben. Dies stellt für kommunale Mobilitätsprojekte, die die Spielräume von Experimentierklauseln und Ausnahmegenehmigungen nutzen wollen, oftmals eine große Herausforderung dar. In diesen Fällen ist es dringend ratsam, diese juristische Fachkenntnis durch die Nutzung entsprechender Beratungsangebote oder über eine Vergabe von Aufträgen zu erschließen. Es gibt bisher leider kaum gut dokumentierte Praxisbeispiele, konkrete Leitfäden oder Handbücher für die Anwendung von Experimentierklauseln im Mobilitätsbereich. Dies gilt insbesondere für nicht (primär) technische Innovationen.
3. Mögliche Auswirkungen und möglicher Beitrag zu einer klimafreundlichen Mobilität
Das Ziel und der große Vorteil von Versuchen und Experimenten besteht darin, dass sie zeitlich befristete Spielräume schaffen, um Alternativen zu erproben und zur gemeinsamen Diskussion zu stellen und so schrittweise Lösungen für eine ökologisch nachhaltige Mobilität zu entwickeln. Die etablierten Strukturen im Verkehr sind bisher nicht darauf ausgelegt, dass dort eine echte Innovationsdynamik stattfindet bzw. dass sich in den Strukturen überhaupt etwas ändert. Die Experimentierklauseln reichen in der bisherigen Auslegungspraxis offensichtlich auch nicht aus, um Innovationen in größerem Maßstab zu erproben (Knie/Ruhrort 2019). Experimente werden durch sie nur insoweit erlaubt, als dass alles andere nicht verändert wird. Damit ermöglicht es die PBefG-Klausel beispielsweise nicht, die Chancen der Digitalisierung für ein vielfältiges öffentliches Verkehrsangebot zu nutzen. Die StVO-Experimentierklausel fokussiert sich auf Ordnung und Sicherheit des Verkehrs und ermöglicht so kaum, weitere notwendige Maßnahmen der nachhaltigen Mobilität und Stadtentwicklung für BürgerInnen erlebbar zu machen und zu erproben. Aktuell (schon seit dem Sommer 2023) wird durch Bund und Länder an einer Änderung des StVG und der dazu gehörigen StVO gearbeitet, die es ermöglichen könnte, neben einer Verbesserung der Verkehrssicherheit auch weitere Ziele einer nachhaltigen kommunalen Mobilitätswende zu verfolgen. Eine solche Änderung hätte großes Potential die Handlungsspielräume für Kommunen zu erweitern und die Anwendung von Experimentierklauseln attraktiver zu machen.
Auch ohne die Nutzung von Experimentierklauseln können Kommunen jedoch heute schon Straßen oder Straßenabschnitte kommunaler Straßen endwidmen und damit völlig frei gestalten. Sondergenehmigungen für Straßenfeste oder öffentliche Veranstaltungen erlauben es zudem ebenfalls, temporär Mobilitätsalternativen und Umgestaltungen des öffentlichen Straßenraums erfahrbar zu machen, ohne dass eine Experimentierklausel genutzt werden muss.
Möglichkeiten, das Verkehrsangebot in Städten zu verbessern, ergeben sich auch durch das 2018 erlassene Carsharing-Gesetz (CsgG) sowie das Elektromobilitätsgesetz (EmoG). Beide Rechtsgrundlagen erlauben Kommunen die Ausweisung von öffentlichen Ladestation und Carsharingstellplätzen auf öffentlichen Flächen.
Leitfäden als Anleitung zur Anwendung von Experimentierklauseln oder zum Aufbau von regulatorischen Experimentierräumen für kommunale Mobilitätsprojekte gibt es aktuell keine. Auch Erfahrungs- und Evaluationsberichte durchgeführter Verkehrsversversuche sind rar. Gerade für die Begleitung und die Evaluation von Verkehrsversuchen oder -experimenten kann die Zusammenarbeit in einem transdisziplinären Team einen großen Mehrwert für die Kommunen bieten. Wissenschaftliche Partner können beispielsweise die Erfassung, Aufbereitung und Auswertung von Daten oder auch den Prozess selbst vielgestaltig unterstützen.
Für den Bereich digitaler Innovation bietet das „BMWI-Handbuch zu Reallaboren“ (BMWI 2019) eine Orientierungshilfe zu zentralen Themenbereichen, die allgemein beim Aufbau regulatorischer Experimentierräume berücksichtigt werden sollten. Neben einem einleitenden Überblick zum Thema Reallabore und regulatorische Experimentierräume werden hier relevante Fragen thematisiert, wie die Festlegung der Ziele eines Experimentierraums und ihre Messbarkeit, die Identifikation rechtlicher Hürden und Spielräume sowie die Auswahl relevanter Akteure für die Phasen von Planung, Aufbau und Umsetzung von Experimentierräumen.
Fachinformationen und wissenschaftlichen Studien
Reallabore und Experimentierräume
Identitätspolitik: Partizipative Forschung und ihre Herausforderungen im Zusammenhang mit sozialer und epistemischer Kontrolle
Studien, Bücher, Fachartikel
In den letzten 20 Jahren ist die Beteiligung von Laien oder Vertretern der Zivilgesellschaft zu einem Leitprinzip in Forschungs- und Innovationsprozessen geworden. Wir argumentieren, zu Konflikten führt, die Ausdruck von Identitätspolitik sind und zu dieser führen. Die Analyse basiert auf konzeptionellen Überlegungen sowie empirischen Erkenntnissen, die im Rahmen des EU-finanzierten CONSIDER-Projekts (2012-2015) entwickelt wurden. (Text in englischer Sprache)
Autodämmerung – Experimentierräume für die Verkehrswende
Positions/-Diskussionspapiere
Obwohl empirisch messbare und relevante Veränderungen in der sozialen Praxis erkennbar sind, bleibt das in Jahrzehnten entstandene Bollwerk zum Aufbau und Schutz des privaten Automobils mit seinen begleitenden Gesetzen bestehen. Und obgleich mit den Optionen digitaler Plattformen neue Produkte und Dienstleistungen möglich sind, scheint für eine grundlegende Revision die Zeit noch nicht reif zu sein.
Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung im Praxislabor: Erfolgsfaktoren und Methoden für Veränderungen
Studien, Bücher, Fachartikel
Der transdisziplinäre Forschungsmodus hat in der Forschung zu und für Nachhaltigkeitstransformationen an Bedeutung gewonnen. Dabei ist die lösungsorientierte Forschung zu komplexen Nachhaltigkeitsproblemen selbst komplex geworden, wofür neue transdisziplinäre Forschungsformate entwickelt und erprobt werden. Die Anwendung neuer Formate bietet Lernpotenziale aus der Erfahrung. (Text in englischer Sprache)
Reallabore. Simulierte Experimente – Simulierte Demokratie?
Studien, Bücher, Fachartikel
Die Einrichtung von Reallaboren stellt in wissenspolitischer Hinsicht die bisher ambitionierteste Form der Expansion von Praktiken des Experimentierens in Gesellschaften dar. Unter den Vorzeichen einer ›Großen Transformation‹ wird der Einrichtung von Reallaboren eine besondere Bedeutung beigemessen.
Nachhaltige Quartiersentwicklung in urbanen Wachstumsregionen: Lokale Quartiersentwicklung: Experimentierräume für eine nachhaltige Entwicklung
Studien, Bücher, Fachartikel
Verschiedenste Akteurinnen und Akteure der Stadtgesellschaft beteiligen sich an der Debatte um die Qualität und Nachhaltigkeit urbanen Lebens und bringen ihre jeweiligen Blickwinkel ein. Viele Städte erkennen und adressieren diese Herausforderungen und erlassen Beschlüsse und Strategien, wie die politisch gesetzten Ziele erreicht und Zukunftsaufgaben bewältigt werden können. Die Aufgaben sind komplex und miteinander verknüpft, daher wundert es nicht, dass zwischen diesen Zielen ebenfalls Konflikte entstehen.
Reallabore als Testräume für Innovation und Regulierung – Ein Leitfaden für Verwaltungen und Unternehmen (BMWi 2019)
Der Leitfaden richtet sich primär an Entscheider in Unternehmen und Verwaltungen, die eine Innovation erproben und einen Testraum für diese Erprobung schaffen wollen. Dieser Leitfaden zeigt, wie die Anforderungen für einen solchen Testraum mit Rahmenbedingungen und Ausgestaltungsoptionen zusammengebracht werden können.
Freiräume für Innovationen Das Handbuch für Reallabore (BMWI 2019)
Das Handbuch bietet einen Überblick zum Themenbereich Reallabor und regulatorischer Experimentierraum im Bereich digitaler Innovationen. Neben Definitionen von Grundbegriffen beinhaltet es Kapitel über den Aufbau und die Umsetzung von Reallaboren und die dortige Nutzung von Experimentierklauseln.
Rechtliche Rahmenbedingenungen
Knie/Ruhrort 2019: Die Neuordnung des öffentlichen Verkehrs. Grundsätze für eine neue zukunftsorientierte Regulierung im Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
Positions/-Diskussionspapiere
Digitale Plattformen ermöglichen eine Vielzahl von neuen Mobilitätsangeboten. Diese neue Vielfalt kann in Zukunft dabei helfen, die Klimaziele der Bunderegierung im Verkehr zu erreichen und die Städte vom privaten Autoverkehr zu entlasten.
Rechtliche Hemmnisse und Innovationen für eine nachhaltige Mobilität (UBA 2019)
Leitfaden / Handbücher
Rechtliche Hemmnisse und Innovationen für eine nachhaltige Mobilität – untersucht an Beispielen des Straßenverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs in Räumen schwacher Nachfrage (UBA 2019)
Erfahrungen und Hinweise zur Nutzung der rechtlichen Spielräume der lokalen Verkehrswende, ohne eine Experimentierklausel zu nutzen.
Praxisbeispiele aus verschiedenen Anwendungsfeldern und Kontexten
Park4SUMP – Städte in Bewegung – Parken im Wandel
Positions/-Diskussionspapiere
Die brandneue Publikation des POLIS Netzwerks mit dem treffenden Titel „Städte in Bewegung“ gibt einen Überblick über die Ergebnisse des Park4SUMP-Projekts. Der Artikel hebt bewährte Verfahren von Park4SUMP hervor und gibt einen Überblick über die Herausforderungen des innerstädtischen Parkens. (Text in englischer Sprache)
Pop-up-Radinfrastruktur als Nischeninnovation für nachhaltigen Verkehr in europäischen Städten
Studien, Bücher, Fachartikel
Die durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufenen Veränderungen im Mobilitätsverhalten haben ein Fenster für einen beschleunigten Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität geöffnet. Wir bewerten empirisch die Auswirkungen einer solchen temporären Infrastruktur in Bezug auf Luftqualität, Verhalten und Akzeptanz, wobei wir uns auf die Stadt Berlin, Deutschland, konzentrieren. (Text in englischer Sprache)
Gesetzestext zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts (Novelle des PBefG)
Gesetz zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts
Vom 16. April 2021
Straßenverkehrsordnungsrechtlicher Rahmen zur Anordnung temporärer und dauerhafter Radfahrstreifen
Studien, Bücher, Fachartikel
Immer mehr Verkehrsteilnehmer konkurrieren um das nur begrenzt zur Verfügung stehende öffentliche Straßenland. Diese Ausarbeitung stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen der Anordnung solcher Radfahrstreifen, sowie Anknüpfungspunkte und Besonderheiten bei der Anordnung von (temporären) Radfahrstreifen dar.
Gesetzestext zum autonomen Fahren vom Juli 2021
Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes – Gesetz zum autonomen Fahren
Experimentelles Parkraummanagement (Verschiedene Stellplatzsatzungen)
Anwohnerparken in Tübingen: Besitzer von SUVs und Minibussen zahlen mehr
Freiburg hatte es schon vorgemacht: In baden-württembergischen Großstädten wird das Parken für Anwohner teurer. In Tübingen zieht der Gemeinderat jetzt nach.
Wirksamkeit Mobilitätskonzepte. Evaluation von Mobilitätsmaßnahmen im Rahmen des Bremer Stellplatzortsgesetztes
(Schluss-)Berichte
Im Rahmen der durchgeführten Evaluation konnte die grundsätzliche Wirksamkeit der Mobilitätskonzepte nachgewiesen werden. Bewohner:innen, die in Immobilien mit Mobilitätskonzepten leben, besitzen weniger Pkw als Bewohner:innen in vergleichbaren Immobilien, denen kein solches Konzept zugrunde liegt. Daher ist grundsätzlich zu empfehlen, den etablierten Mechanismus beizubehalten und fortzuführen, der vorsieht, die Zahl der zu errichtenden Stellplätze bei Vorliegen eines schlüssigen Mobilitätskonzepts zu reduzieren.
Festlegung von Mindest- und Höchstzahl von Pkw-Stellplätzen in der Einschränkung- und Verzichtssatzung (0,65 SP/WE), Darmstadt (Lincoln-Siedlung)
Leitfäden / Handbücher
[Magistratsvorlage: 2016/0305]
1. Änderung der Satzung über die Einschränkung der und den Verzicht auf die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen in der Lincoln-Siedlung (Einschränkungs- und Verzichtssatzung Lincoln-Siedlung)
Regelungen zum Stellplatzbau als Steuerungsinstrument in der Stadt- und Mobilitätsplanung. Europäische Erfahrungen und Praxis
Leitfäden / Handbücher
Im Rahmen des Horizon 2020-Programms der EU haben sich im Projekt Park4SUMP
16 europäische Städte und mehrere Forschungspartner zusammengeschlossen, um
die Vorteile des strategischen Parkraummanagements für nachhaltige urbane Mobilität
aufzuzeigen. Städte sollen nicht nur zu einer aktiven Parkraumpolitik ermutigt werden,
sondern sie sollten diesen Handlungsbaustein für einen nachhaltigen Stadtverkehr in ihren
Verkehrsentwicklungsplan (VEP) bzw. in einen vergleichbaren Mobilitätsplan (z.B. Sustainable
Urban Mobility Plan (SUMP), meist übersetzt als „nachhaltiger Mobilitätsplan“) integrieren.
Fahrradabstellplatzsatzung, München
Die Fahrradabstellplatzsatzung (FabS) der Landeshauptstadt München soll dazu dienen, dass auch auf den privaten Baugrundstücken eine ausreichende Anzahl von Fahrradabstellplätzen bereit steht.
Stellplatzsatzung § 2 (2), München
Satzung der Landeshauptstadt München über die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung – StPlS)
§ 4 (5) Öffnungsklausel in Parkgebührenverordnung und Stellplatzsatzung, München
Verordnung über Parkgebühren in Bereichen mit Parkscheinautomaten in der Landeshauptstadt München (Parkgebührenordnung)
Stellplatzsatzung der Stadt Oberursel
Satzung der Stadt Oberursel (Taunus)
über Stellplätze sowie Fahrradabstellplätze
Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung
Leitfaden zur Stellplatzsatzung der Stadt Oberursel
Leitfaden zur Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über Stellplätze für Pkw sowie Fahrradabstellplätze. Die Änderungen der alten Stellplatzsatzung von 2013 haben zum Ziel, den Flächenverbrauch bei der Stellplatzherstellung zu verringern und damit den ruhenden Verkehr im Straßenraum sowie die Baukosten zu reduzieren.
Gutachten zu Gestaltungsspielräumen und Akzeptanz kommunaler Verkehrswendepolitik
Untersuchung von Einstellungen gegenüber einer Neuaufteilung öffentlicher Räume zulasten des Autoverkehrs
Studien, Bücher, Fachartikel
Die Akzeptanz für einschränkende Maßnahmen des MIV erscheint als notwendige Voraussetzung für eine Verkehrswende. Angesichts dieser Gemengelage stellt sich die Frage, inwieweit sich in den Großstädten ein „Mainstreaming“ autokritischer Haltungen behaupten kann. Soziologisch besonders relevant ist dabei die Frage, wie sich die Unterstützung für oder die Ablehnung gegen entsprechende Maßnahmen und Leitbilder in der Bevölkerung verteilt.
Anforderungen an das Verkehrsrecht durch das Bundesverfassungsgericht
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 war bahnbrechend: Der Gesetzgeber wurde in die Pflicht genommen, bei der Klimagesetzgebung auch zukünftige Generationen mitzubedenken. Wie sich nun der Gestaltungsraum der Kommunen im Bereich der nachhaltigen Mobilität verändert, zeigt das Rechtsgutachten von BBG und Partner.
Praxisbeispiele aus verschiedenen Anwendungsfeldern und Kontexten
Input Ulrich Berghof, Drolshagen (Automatisiertes Shuttle im öffentlichen Straßenraum) auf dem BeNaMo Workshop „Evaluation der Projekte & Erfahrungsaustausch zu Experimentierklauseln und Experimentierräumen“ am 05.11.2021
Drolshagen (Kreis Olpe in Südwestfalen) ist eine kleine Stadt mit rund 12.000 Einwohner*innen, die verteilt in insgesamt 58 Ortschaften leben. Die regelmäßige Versorgung mit dem…
Input Felix Weisbrich, Berlin (Pop-up Radwege) auf dem BeNaMo Workshop „Evaluation der Projekte & Erfahrungsaustausch zu Experimentierklauseln und Experimentierräumen“ am 05.11.2021
Für Felix Weisbrich ist Geschwindigkeit in der lokalen Verkehrswende sehr wichtig. Die im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eingeführten geschützten Radwege wurden nach einer anfangs temporären Anordnung innerhalb eines Jahres verstetigt (d. h. baulich umgesetzt).
 Einfache Sprache
Einfache Sprache