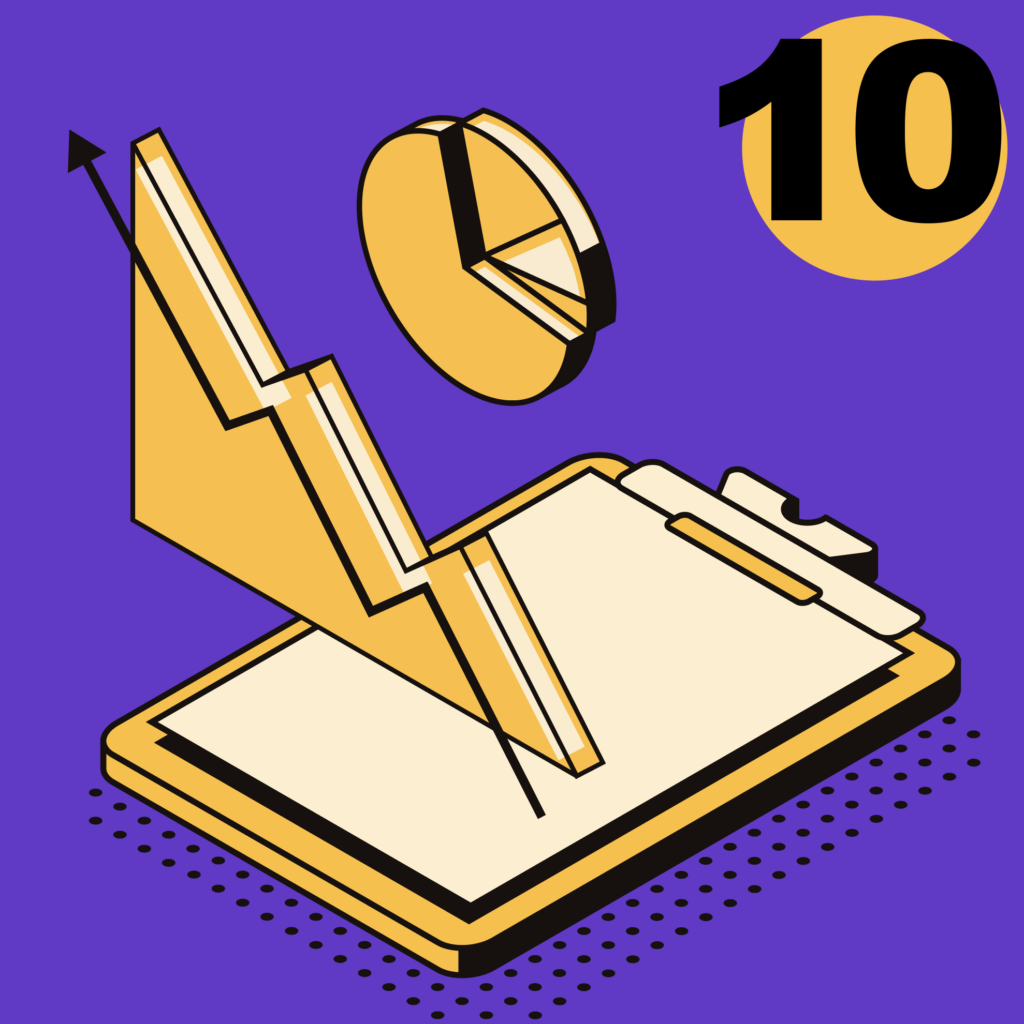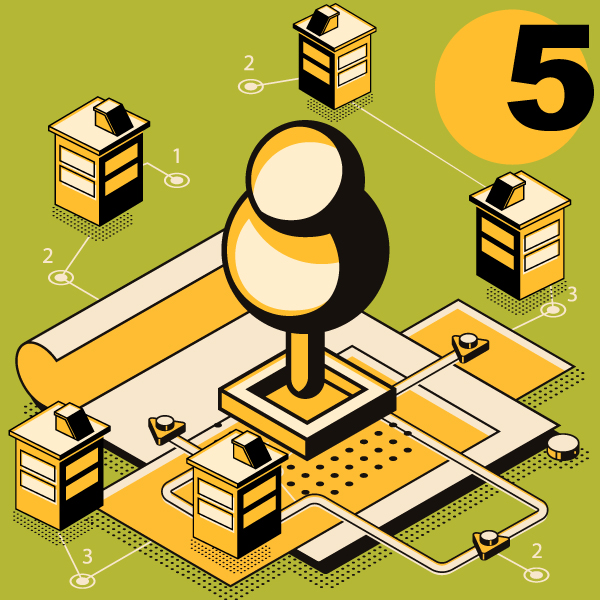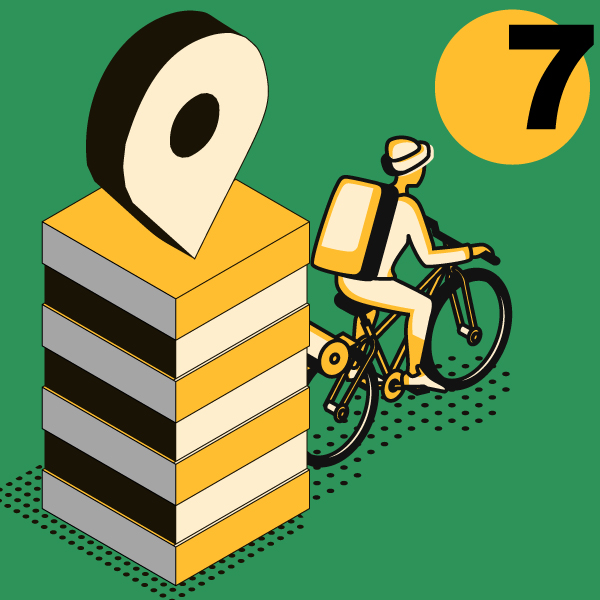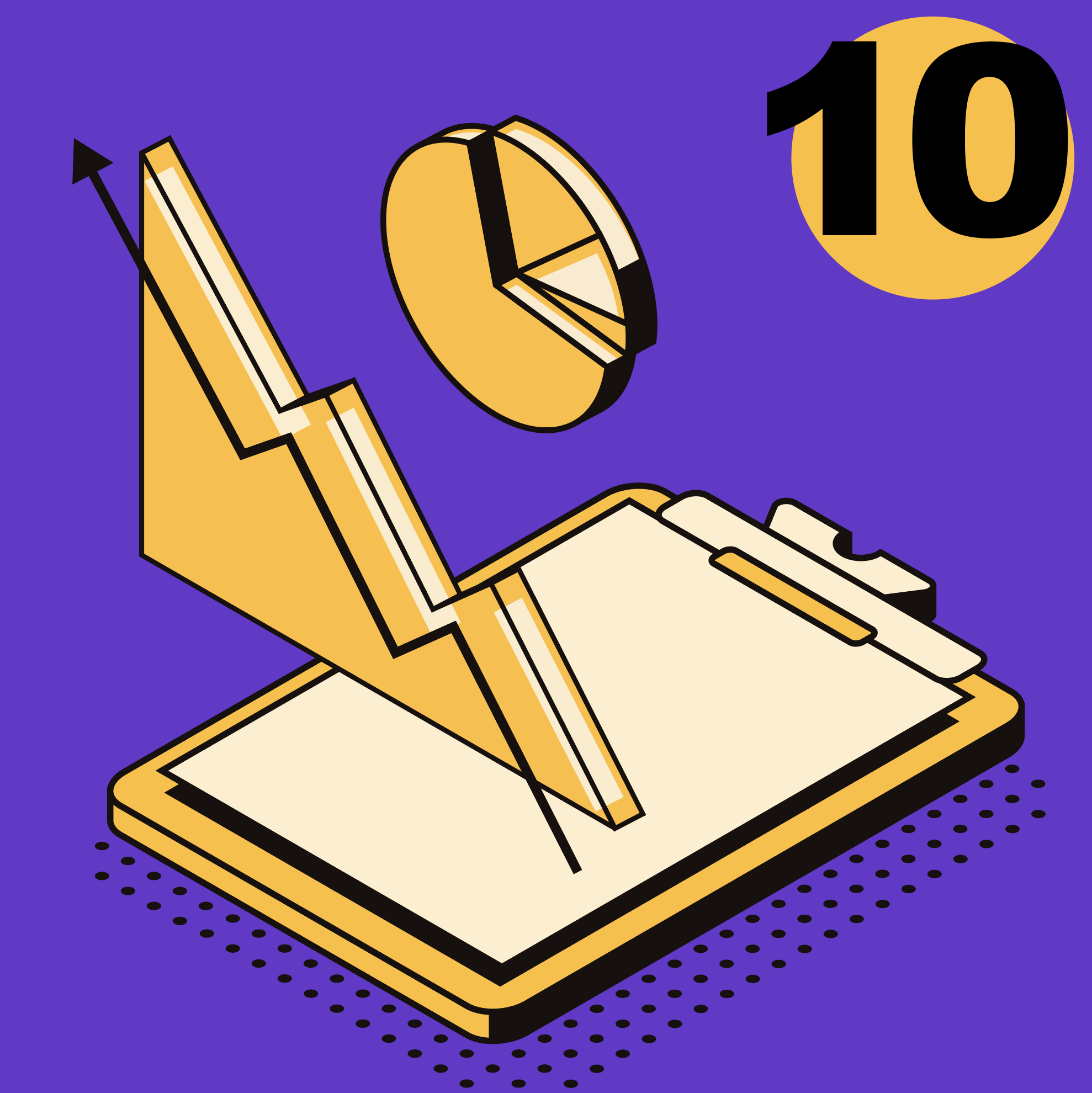
Mobilitätsdaten
1. Definition und Ziele
Mobilitätsdaten werden in Deutschland in mehreren umfangreichen Befragungen erhoben. Die wichtigsten sind „Mobilität in Deutschland“ (MiD), das „System repräsentativer Verkehrserhebung“ (SrV) und das „Deutsche Mobilitätspanel“ (MOP). Daten zur Verkehrsleistung und Strukturdaten zur Verkehrsinfrastruktur und zur Ausstattung sowie Verbreitung von Verkehrsmitteln lassen sich in den jährlichen Berichten „Verkehr in Zahlen“ sowie in verschiedenen Statistiken von Destatis finden. In jüngster Zeit wird verstärkt mit digitalen Erhebungsmöglichkeiten sowie mit der Nutzung von Mobilfunkdaten experimentiert. Nach wie vor dominieren jedoch die klassischen Erhebungen, die auf Selbstauskünften der Befragten beruhen.
Die bundesweite Haushalts- und Personenbefragung „Mobilität in Deutschland“ (MiD) erfasst, zuletzt in 2017, im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) neben soziodemografischen Basisdaten verschiedene Mobilitätsmerkmale und die Alltagsmobilität der Menschen in Deutschland. In den telefonisch, schriftlich und online durchgeführten Befragungen werden zudem detaillierte Informationen über die Wege erhoben, die von den Befragten an dem jeweiligen Berichtstag zurückgelegt werden. Die Studie erlaubt damit, neben der alltäglichen Verkehrsmittelnutzung, auch Unterwegszeiten, Streckenlängen und Zwecke der getätigten Wege zu analysieren. Die Ergebnisse werden gewichtet, sie sind repräsentativ und können auf die Grundgesamtheit bundesweit und bei entsprechender Beauftragung auch auf Landesebene hochgerechnet werden. Was die Studie MiD auf Bundes- und Länderebene liefert, stellt das „System repräsentativer Verkehrsbefragungen“ (SrV), das auch unter dem Namen „Mobilität in Städten“ firmiert, für einzelne Städte und Gemeinden bereit. Auch beim SrV handelt es sich um eine ganzjährliche Befragung, die zuletzt 2018 online und telefonisch stattfand. Sie beinhaltet neben soziodemografischen und mobilitätsbezogenen Merkmalen ebenfalls eine Stichtagswegeerfassung. Grundgesamtheit des SrV ist die Wohnbevölkerung der jeweiligen Städte und Gemeinden in Deutschland. Darüber hinaus wird vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) seit 1994 das Mobilitätsverhalten im Alltag im Rahmen des „Deutschen Mobilitätspanels“ (MOP) erhoben.
Zunehmend wichtiger werden digitale Methoden zur Erfassung von Mobilitätsdaten. Ein solches Instrument ist beispielsweise die auch kommerziell eingesetzte App „infas mobico“, die als Trackingdienst die Mobilitätsmuster der Teilnehmenden kontinuierlich und ganztägig aufzeichnet. Dabei muss ein hohes Maß an Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet werden. Die Teilnehmenden müssen jederzeit die Möglichkeit haben, die Aufzeichnung zu beenden oder zu pausieren, die App zu deinstallieren und die Löschung bereits aufgezeichneter Daten zu veranlassen. Die Datenbereitstellung erfolgt über ein Dashboard, in dem auch Datensätze zum Speichern ausgewählt und der Verlauf der Rekrutierung und Teilnahme nachvollzogen werden kann.
Die mit digitalen Mobilitätsdaten verbundenen Hoffnungen sind groß. Aggregierte digitale Mobilitätsdaten aus sehr unterschiedlichen, teils auch ganz spezifischen Erhebungen können die Basis für neue Mobilitätsdienstleistungen bilden. Für diesen Zweck wurden auf Initiative des Bundesverkehrsministeriums erste Plattformen, die mCloud und der Mobilitätsdatenmarktplatz, bereitgestellt. Bisher steht die erhoffte Bündelung von Mobilitätsdaten aber noch ganz am Anfang.
2. Probleme und Herausforderungen
Damit sich Hoffnungen auf eine integrative Verwendung von digitalen Mobilitätsdaten überhaupt erfüllen können, müssen sie verfügbar und bezahlbar sein. Es besteht die Gefahr, dass kommerzielle Interessen einer allgemeinen Verfügbarkeit entgegenstehen. Der Grundsatz des Open Access von Mobilitätsdaten ist daher wesentlich, wird bisher allerdings erst ansatzweise realisiert. Der vom Bundesverkehrsministerium initiierte Mobilitätsdatenmarktplatz soll eine neutrale Plattform von Mobilitätsdatenanbietern sein. Alle Unternehmen, die im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) Mobilitätsangebote unterbreiten, sind verpflichtet, statische und dynamische Daten im Linien- und Gelegenheitsverkehr und auch die Zugangsstellen betreffend zur Verfügung zu stellen. Andere, wie die digitalen Plattformkonzerne, müssen das bisher jedoch nicht, sie können ihre Datenschätze exklusiv nutzen oder eben lukrativ vermarkten.
Die Daten zum Mobilitätsverhalten in den Befragungen „Mobilität in Deutschland“ (MiD), „System repräsentativer Verkehrserhebung“ (SrV) und dem „Deutschen Mobilitätspanel“ (MOP) sind in Zeitreihen dokumentiert. Diese zeigen Veränderungen und Konstanten über lange Zeiträume. Darin wird ein erheblicher Mehrwert gesehen. Kurzfristige und disruptive Änderungen im Verkehrsverhalten lassen sich allerdings so nicht erfassen. Veränderungen im Verkehrsverhalten, auch unter radikal veränderten Rahmenbedingungen, werden bisher lediglich in Simulationsmodellen betrachtet. Diese beruhen jedoch auf gesetzten Annahmen und können die Komplexität sozialer Prozesse nur unzureichend abbilden. Sie tun sich zudem schwer, den Routinecharakter von Verkehrshandeln zu berücksichtigen. Im Übrigen können Simulationen immer nur so gut sein wie die eingespeisten Daten. Sozialwissenschaftliche empirische Verkehrserhebungen unter Realbedingungen – sowohl in standardisierten Befragungen als auch in qualitativen Interviews – sind daher unverzichtbar, um Mobilitätsmuster und ihre (potenziellen) Änderungen erfassen zu können. Zukünftig kann eine verbesserte Datengrundlage mithilfe neuer digitaler Erhebungsmethoden erreicht werden.
Die Herausforderung der auf das Mobilitätsverhalten bezogenen Datenerhebungen besteht darin, ein methodisch breites Untersuchungsdesign einzusetzen. Dies zeigt sich in jüngster Zeit beispielhaft in Untersuchungen der Veränderungen von Mobilität unter Bedingungen der Corona-Pandemie (z. B. Mobicor). Es war und ist die Frage zu beantworten, welche und wie viel Mobilität unverzichtbar ist, um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Offen ist, welche neuen Routinen sich unter den Restriktionen der Pandemie entwickeln und ob diese auch unter erneut veränderten Bedingungen Bestand haben (siehe auch Rasche et al. 2021). Zu untersuchen ist ferner, wie flexibel Menschen in unterschiedlichen Situationen mit verschiedenen Handlungsspielräumen sind und wer diese überhaupt nutzen kann. Als vielversprechend erscheint eine Kombination von quantitativen Daten zu Mobilität und Verkehr und mit qualitativen Befragungen eines aus verschiedenen Personengruppen zusammengesetzten Panels.
Alle Erhebungen von Verkehrsverhalten und Bewegungsdaten müssen die Anforderungen der Datensicherheit und des Datenschutzes sorgsam erfüllen. Hier ist generell eine hohe Sensibilität zu erwarten. Bewegungsdaten sind wichtig, um attraktive Mobilitätsangebote machen zu können, sie erfordern den Schutz der Privatsphäre. Wie dieser mit Anonymisierungsverfahren gewährleistet werden kann, wird in dem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt FreeMove untersucht und erprobt. Das stellt auch die Kommunen vor große Herausforderungen, da sie nicht nur den gesetzlichen Datenschutz gewährleisten müssen, sondern überhaupt einen verantwortungsvollen Umgang mit den erhobenen oder erworbenen Verkehrsdaten dokumentieren müssen. Dies ist nicht zuletzt deshalb relevant, um die Akzeptanz bei den Nutzerinnen und Nutzern von Mobilitätsangeboten zu sichern.
Generell spricht viel für ein landesweites „Mobilitätspanel“, das die Mobilitätsroutinen, Bedürfnisse und Einstellungen der Bevölkerung in den Blick nimmt. Zentral für diese Befragung nach den subjektiven Einschätzungen ist die Differenzierung der Befragten nach soziodemografischen sowie räumlichen Kriterien sowie nach ihren professionellen Positionen. So kann es gelingen, die Vielfalt der Lebenssituationen und die damit verbundenen unterschiedlichen Freiheitsgrade in der Organisation von Alltagsmobilität bzw. umgekehrt faktische Mobilitätszwänge zu erfassen.
3. Mögliche Auswirkungen und möglicher Beitrag zu einer klimafreundlichen Mobilität
Mobilitätsdaten müssen hinreichend aktuell und robust sein, um sie in der verkehrspolitischen Diskussion nutzen zu können. Aber nicht nur das. Auch für die Verkehrsplanung und für attraktive Verkehrsangebote sind belastbare Mobilitätsdaten unverzichtbar. Nicht zuletzt werden sie gebraucht, wenn innovative Lösungswege für die Mobilitätswende identifiziert und strategische Handlungsempfehlungen zur Unterstützung der Mobilitätswende gegeben werden sollen. Manche Anwendungen sind ganz konkret und kleinteilig: Das gilt beispielsweise für die Einrichtung und die Ausgestaltung von Mobilitätsstationen und für das Design von Angeboten des betrieblichen Mobilitätsmanagements. Da bedarf es Daten darüber, welche Wege von welcher Länge mit welchen Verkehrsmitteln von wem zurückgelegt werden und wieviel Zeit dafür benötigt wird. Das gilt aber auch für multimodale Verkehrsangebote, deren Zuverlässigkeit und damit die Attraktivität von lückenlosen und präzisen Verkehrsbetriebsdaten und Informationen zu Anschlüssen in Echtzeit abhängen. Multimodale Mobilitätsmuster sind auf integrierte Mobilitätsdaten angewiesen. Neben klassischen Verkehrserhebungen und -zählungen sind hier mobilfunkbasierte Tracking-Tools oftmals vielversprechende Instrumente.
Für die Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität sind neben objektiven Daten und damit beschreibbaren Mobilitätsmustern auch dahinterliegende Mobilitätsbedürfnisse und -zwänge sowie Umstiegs- und Vermeidungspotenziale von Wegen und Transporten relevant. Eine effizientere Organisation des Verkehrs und eine Vermeidung von Wegen und ihren Anlässen bedarf Informationen und Wissen über die Entstehung von Verkehr. Das ist mehr als eine reine Datensammlung.
Fachinformationen und wissenschaftliche Studien
Weiterführende Literatur zur Kontextualisierung
Mobilitätsdaten nutzen und personenbezogene Daten schützen
Wissenschaftliche Studie
Neue Verkehrsformen und weitere Möglichkeiten zur Erhebung und Bereitstellung von Mobilitätsdaten erfordern in zunehmendem Maße, auch den Schutz personenbezogener Daten im Blick zu behalten. Wie aus rechtswissenschaftlicher Perspektive ein Umgang mit Mobilitätsdaten aussehen kann, der gleichermaßen die Nutzbarkeit der Daten und den Schutz personenbezogener Daten sicherstellt, soll in diesem Beitrag dargestellt werden.
Leitlinien zum Umgang mit Mobilfunkdaten
Discussion Paper
Dieses Discussion Paper des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) stellt eine hilfreiche Diskussionsgrundlage zum komplexen Umgang mit Mobilfunkdaten dar. Basierend auf 9 formulierten Leitthesen wird dabei zum einen über mögliche methodische Effekte informiert und zum anderen eine Diskussion über die Notwendigkeit höherer Transparenz in der Datenaufbereitung angestoßen.
Chancen und Herausforderungen beim Umgang mit Bewegungsdaten im wirtschaftlichen und behördlichen Kontext
Wissenschaftliche Studie
Dieser im Rahmen des MZL-Projekts „Freemove“ entstandene Artikel bietet anhand von 13 Experteninterviews einen Einblick in den aktuellen behördlichen und unternehmerischen Umgang mit Bewegungsdaten. Dabei wird zum einen deutlich, welche Unsicherheiten bezüglich der Anonymisierungstechniken herrschen und zum anderen, dass die akademische Diskussion über den (sicheren) Umgang mit Mobilitätsdaten von der Praxis noch zu weit entfernt liegt. Entsprechend spricht sich der Beitrag dafür aus, Unternehmen und Behörden mehr benutzerfreundliche Tools zur Vereinfachung der Implementierung von Methoden zur Verbesserung der Privatsphäre an die Hand zu geben.
Zentrale Erhebungen und Verkehrsstatistiken in Deutschland
Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zu Nachhaltigkeitsindikatoren der Bundesregierung
Mit den Indikatorenberichten zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie liefert das Statistische Bundesamt seit Juli 2019 Daten zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland sowie beschreibende Informationen zu den Indikatoren. Dazu werden Informationen auf einer Online Plattform in aufbereiteter und interaktiver Form zur Verfügung gestellt.
„EXDAT-Experimentelle Daten“ zu COVID-19 und Mobilität des Statistischen Bundesamtes (Destatis)
Analyse spezifischer Mobilitätsindikatoren auf Basis anonymisierter und aggregierter Mobilfunkdaten aus dem Netz des Mobilfunkanbieters Telefónica.
Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zum Themenfeld Transport und Verkehr
Zusammenstellung amtlicher Verkehrsstatistiken zu Verkehrsleistungen, Beförderungsunternehmen, Verkehrsmittelbeständen und Verkehrsinfrastruktur des Personen- und Güterverkehrs.
Verkehr in Zahlen (von DLR und DIW im Auftrag des BMDV)
„Verkehr in Zahlen“ (ViZ) ist seit nunmehr mehr als 50 Jahren das Standardwerk der Verkehrsstatistik in Deutschland. Das Kompendium enthält auf rd. 350 Seiten aktuelle Zahlen und Zeitreihen zu allen relevanten Themen aus den Bereichen Mobilität und Verkehr.
Deutsches Mobilitätspanel (MOP, vom Karlsruhe Institut für Technologie KIT)
Das Deutsche Mobilitätspanel (MOP) erhebt seit 1994 jährlich Informationen zur deutschen Verkehrslage und zum Mobilitätsverhalten der Bevölkerung – beispielsweise darüber, wann, wofür und mit welchen Verkehrsmitteln Menschen in Deutschland unterwegs sind. Dazu werden Haushalte zu ihrem Mobilitätsverhalten im Alltag und zu ihrer Pkw-Nutzung befragt. Mit diesen Informationen leisten sie einen wichtigen Beitrag zur sinnvollen Gestaltung von Verkehrssystemen.
Mobilität in Städten (SrV, von TU Dresden)
Die Verkehrserhebung „Mobilität in Städten“, gegründet 1972 als „System Repräsentativer Verkehrserhebungen (SrV)“, dient der Ermittlung von Mobilitätskennzahlen der städtischen Wohnbevölkerung. Einerseits werden wichtige Datengrundlagen für die kommunale Verkehrsplanung regelmäßig aktualisiert und auf Basis eines einheitlichen Erhebungsdesigns ausgewertet. Andererseits können stadtübergreifende Trends in der Verkehrsentwicklung und deren Randbedingungen anhand großer Stichproben recherchiert werden.
Mobilität in Deutschland (MiD, von DLR und infas)
Mobilität in Deutschland (MiD) ist die bundesweit größtangelegteste Befragung von Haushalten zu ihrem alltäglichen Mobilitätsverhalten im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Verkehr (BMDV). Sie wurde bereits in den Jahren 2002, 2008 und 2017 erhoben. Die aktuelle Erhebung wird von Dezember 2022 bis voraussichtlich Anfang 2024 durchgeführt. Die Ergebnisse werden ab Ende 2024 vorliegen.
Zentrale Mobilitätsdatenplattformen in Deutschland
Berlin Mobility Data Hub
Diese aus einem Forschungsprojekt der TU Berlin und FU Berlin entstandene Datenplattform bietet Zugriff auf eine Vielzahl von Datensätzen aus der Mobilitäts- und Transportwelt. Ein Schwerpunkt der aufbereiteten Daten liegt dabei insbesondere auf der Analyse von Auswirkungen von COVID-19 auf das Transport- und Mobilitätsverhalten.
Emmett-Netzwerk im Kontext der mFund-Aktivitäten des BMDV
Emmett ist eine offene Kommunikations- und Vernetzungsplattform zu datengetriebener Mobilität.
Die vom BMDV betriebene Plattform bietet einen Einblick in die aktuelle Forschung und Entwicklung innovativer Mobilität in Deutschland und in die Projekte der Forschungsinitiative mFUND des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV).
Auf Emmett vernetzen sich Menschen aus der Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sowie Fördernehmer*innen und interessierte Bürger*innen, um die Zukunft der Mobilität gemeinsam zu gestalten.
Mobilithek (vom BMDV)
Die Mobilithek – bereitgestellt vom BMDV – ist eine Plattform, die den Zugang zu offenen Mobilitätsdaten in Deutschland bietet und den B2B-Austausch von Datenangeboten ermöglicht.
Hinweis: Ab Mitte 2022 werden die weiteren vom BMDV bereitgestellten Datenplattformen – Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) und das offene Datenportal mCLOUD – sukzessive in der Mobilithek aufgehen und bis spätestens Ende 2023 ihren Betrieb einstellen. Bis dahin baut die Mobilithek auf den beiden Plattformen auf.
Mobilitätsdatenmarktplatz (nach PBefG, initiiert vom BMVI, betrieben von der Bundesanstalt für Straßenwesen BaSt)
Der Mobilitätsdatenmarktplatz (MDM) stellt den Nationalen Zugangspunkt für Mobilitätsdaten dar. Der Marktplatz stellt eine neutrale Plattform für den Datenaustausch bereit, auf der sichere Daten- und Kommunikationsstandards gelten sowie transparente Konditionen und hohe Sicherheit der Daten gewährleistet werden sollen.
mCLOUD ( vom BMDV)
Die mCLOUD ist eine Rechercheplattform zu offenen Daten aus dem Bereich Mobilität und angrenzender Themen. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) stellt mit der mCLOUD einen zentralen Zugangspunkt zu allen offenen Daten seines Geschäftsbereiches zur Verfügung und öffnet das Portal auch für private Anbieter aus dem Mobilitätsbereich, um ihre Daten dort anzubieten.
Hinweis: Ab Mitte 2022 werden die weiteren vom BMDV bereitgestellten Datenplattformen – Mobilitätsdatenmarktplatz (MDM) und das offene Datenportal mCLOUD – sukzessive in der Mobilithek aufgehen und bis spätestens Ende 2023 ihren Betrieb einstellen. Bis dahin baut die Mobilithek auf den beiden Plattformen auf.
Praxisbeispiele aus verschiedenen Anwendungsfeldern und Kontexten
Einschlägige Forschungsprojekte aus der Forschungsagenda „Nachhaltige urbane Mobilität“
Kompass – Entwicklungs- und Veränderungsprozesse der Alltagsmobilität in regionalen Zukunftslaboren
Die Projektziele von Kompass bestehen darin, evidenzbasiert, unter Nutzung einer einzigartigen, erstmals harmonisierten und um externe Variablen angereicherten MiD/SrV-Datenbasis Handlungsoptionen zu nachhaltiger Mobilität bereitzustellen, welche einen verbesserten Zugang zu Mobilität insbesondere für ökonomisch schlechter gestellte Bevölkerungsgruppen ermöglichen.
FreeMove – Transdisziplinäre Erforschung der Datenschutz-bewussten Verfügbarmachung von Bewegungsdaten für nachhaltige und urbane Mobilität
freemove ist ein vom BMBF gefördertes, transdisziplinäres Projekt zur Erforschung von Mobilitätsdaten. Die Forschungsgruppe vereint die Kompetenzen von universitären und praktischen Partner:innen aus den Bereichen Machine Learning, Digitale Selbstbestimmung, Human-Centered Computing und Informationssicherheit. Das transdisziplinär angelegte Projekt widmet sich der zentralen Forschungsfrage, wie eine datenschutzbewusste Erhebung von Mobilitätsverhalten erfolgen kann und erprobt dies in einer Reihe von Feldstudien.
MOBICOR – Mobilität zu Zeiten von Corona
Corona hat die Mobilität in Deutschland verändert. Doch was genau ist passiert und wie nachhaltig sind die zu beobachtenden Veränderungen? In Kooperation mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und auf Basis einer Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) geht die MOBICOR-Studie mit dem neuen umfragebasierten Mobilitätspanel MOBICOR bundesweit diesen Fragen nach.
 Einfache Sprache
Einfache Sprache